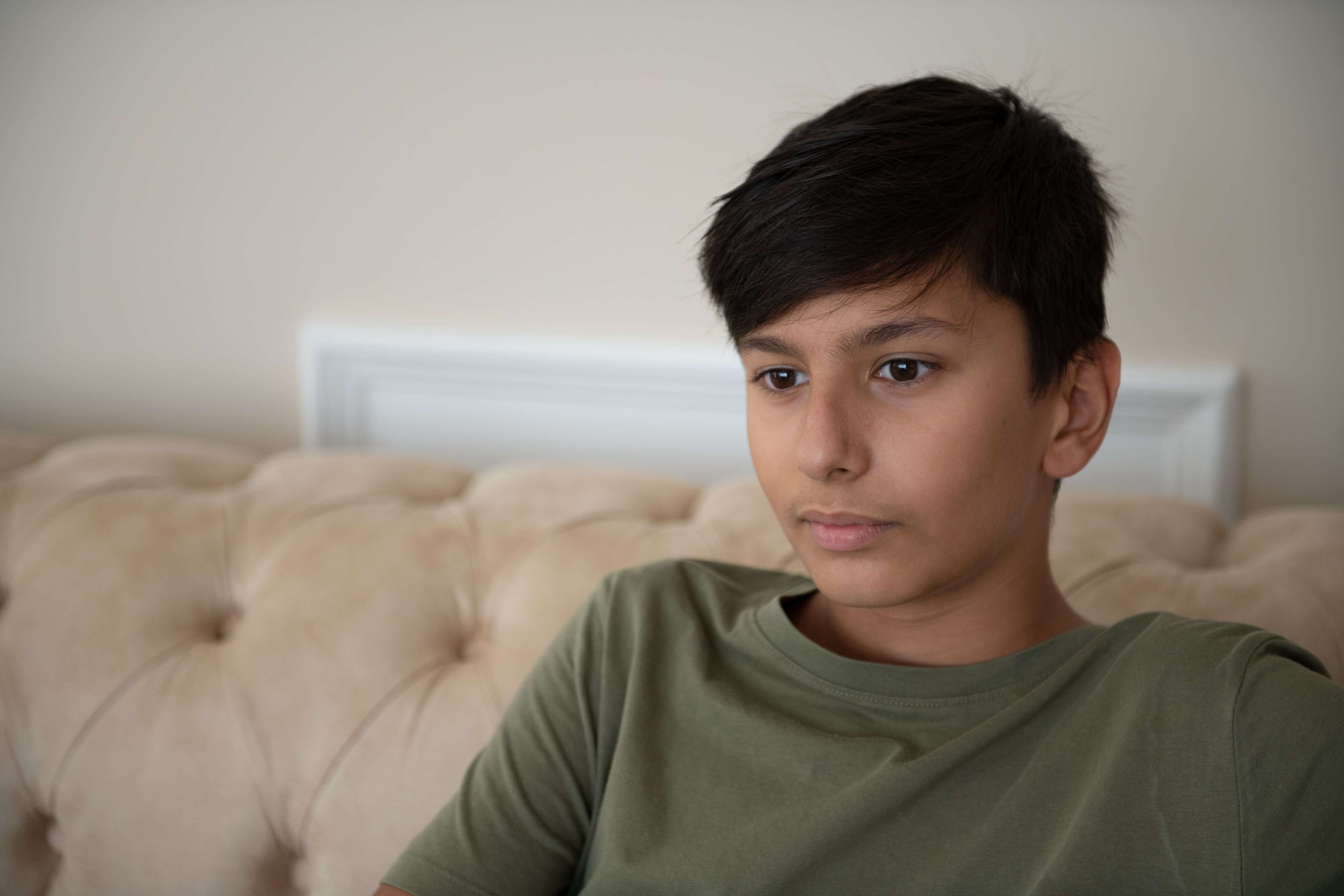Berlin, 31.03.2025. Wie kann die Aufarbeitung digitaler sexueller Gewalt gelingen – und welche Erkenntnisse aus Forschung, internationalen Beispielen und Betroffenenperspektiven helfen dabei, bestehende Schutzkonzepte weiterzuentwickeln? – Diese Fragen standen im Zentrum der Veranstaltung der Lectures-Reihe des „Bündnis gegen sexuelle Gewalt im Netz“, zu der die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM), Kerstin Claus, und der Direktor der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ), Sebastian Gutknecht, heute in Berlin eingeladen hatten. Gemeinsam richten sie das „Bündnis gegen sexuelle Gewalt im Netz“ aus, das seit 2023 den „Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ dabei unterstützt, die Anliegen des Kinderschutzes im digitalen Umfeld zu identifizieren, zu vertreten und Lösungsansätze zu entwickeln.
Kerstin Claus betonte: „Aufarbeitung ermöglicht Betroffenen Anerkennung, Unterstützung und Gerechtigkeit. Dies ist elementar, egal ob Gewalt offline oder online verübt wird. Für den Bereich digitaler sexueller Gewalt brauchen wir dringend Strategien, um besseren Schutz für Kinder und Jugendliche zu gewährleisten. Viel zu lange schon hat Politik hochproblematische und für junge Menschen immens schädliche Entwicklungen zugelassen. Dadurch wurde und wird eine Generation junger Menschen nach der anderen einem immensen Risiko von sexueller Gewalt ausgesetzt. Ganz besonders freue ich mich, dass wir uns heute über international erfolgreiche Ansätze im Kampf gegen digitale sexuelle Gewalt austauschen, denn das Netz kennt keine Grenzen. Deswegen ist es uns auch so wichtig, hier die Perspektiven von Betroffenen sichtbar zu machen und einzubeziehen Wir können nicht länger hinnehmen, dass der Kinderschutz, den wir für die analoge Welt klar geregelt haben, im Netz völlig ausgehebelt wird."
Claus unterstrich, wie wichtig es hierfür sei, auch Künstliche Intelligenz als eigene Dimension einer sich immer weiter beschleunigenden digitalen Transformation zu betrachten. Es sei wichtig, ihre Potentiale ebenso wie die damit verbundenen Risiken zu identifizieren und entsprechend zu handeln.
Ein zentrales Element der Veranstaltung war die Vorstellung des „Internet Investigation Reports“ durch John O’Brian von der britischen Aufarbeitungskommission „Independent Inquiry into Child Sexual Abuse" (IICSA). Der Bericht analysiert systematisch, wie digitale Technologien zur Verbreitung sexueller Gewalt an Kindern genutzt werden – und wie institutionelles Versagen dazu beiträgt, dass Kinder und Jugendliche nicht geschützt wurden. Die Ergebnisse lieferten wertvolle Anhaltspunkte für den deutschen Kontext, wie Claus hervorhob.
Ergänzt wurde die internationale Perspektive durch die Präsentation von Jacques Marcoux vom „Canadian Centre for Child Protection", der Forschungsergebnisse zur digitalen sexuellen Gewalt aus Sicht Betroffener vorstellte. Seine Ausführungen machten deutlich, wie tief die Erfahrungen digitaler Gewalt in das Leben der Betroffenen eingreifen – und welche Verantwortung daraus für unterschiedliche Akteure entstehen, beispielsweise, wenn es darum geht, Missbrauchsdarstellungen aus dem Netz zu löschen.
Die Stimmen Betroffener bildeten auch in der weiteren Diskussion einen zentralen Bezugspunkt durch Beiträge der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs und des Betroffenenrats bei der UBSKM. Unter der Leitfrage, welche Rolle die Aufarbeitung digitaler sexueller Gewalt künftig in Deutschland spielen muss, diskutierten die Teilnehmenden über dringend notwendige Weiterentwicklungen. Dazu zählen unter anderem die konsequente Ausrichtung von Aufarbeitungsprozessen an den Bedürfnissen Betroffener sowie ein sensibler Umgang mit Risiken der Retraumatisierung.
Weiterhin wurde im Rahmen der Veranstaltung thematisiert, welche Herausforderungen durch neue Technologien wie KI entstehen und welche Rolle Anbieter von Online-Diensten, Politik, Eltern und Schule für die Bekämpfung von digitaler sexueller Gewalt in der Zukunft spielen müssen. Deutlich wurde: Digitale sexuelle Gewalt mache nicht an Landesgrenzen halt und erfordere auch internationale Lösungsansätze. Aber auch innerhalb Deutschlands müssten Aufarbeitung und künftige Präventions- und Interventionsmaßnahmen interdisziplinär gedacht und umgesetzt werden. Betroffene bräuchten niedrigschwellige, verlässliche Anlaufstellen, sichere Räume im Netz, Schutz vor Retraumatisierung und gesellschaftliche Anerkennung des erfahrenen Unrechts. Diskutiert wurde über geeignete Maßnahmen für künftige Generationen: Altersverifikationen, Handyverbote, Aufklärungskampagnen sowie Verpflichtungen zur Entfernung von Missbrauchsdarstellungen aus dem Netz waren nur einige der Aspekte, die im Raum standen.
Mit der heutigen Veranstaltung setzt das „Bündnis gegen sexuelle Gewalt im Netz" seine Lectures-Reihe fort, die der Wissensvermittlung, dem interdisziplinären Austausch und dem Aufbau eines Expert:innenpools dient. Nach Veranstaltungen zu „Künstlicher Intelligenz und Kinderschutz“ sowie „Technischem Jugendmedienschutz“ rückte mit der heutigen Lectures-Reihe erstmals explizit die Aufarbeitung digitaler sexueller Gewalt in den Fokus.
„Die Vorträge und Diskussionen zeigen einmal mehr: Die digitale Dimension sexualisierter Gewalt erfordert entschlossenes Handeln von uns allen. Wir brauchen grenzübergreifende Lösungen, klare Verantwortlichkeiten und eine stärkere politische Verankerung des Themas,“ fasste Claus zusammen.
Das „Bündnis gegen sexuelle Gewalt" im Netz berät den Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und unterstützt diesen dabei, Schutz, Prävention und Aufarbeitung im digitalen Raum zukunftsfest zu gestalten.
Wir bieten regelmäßig Praktikumsplätze im Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit/Social Media an.
Weitere Informationen: Zu den Stellenangeboten